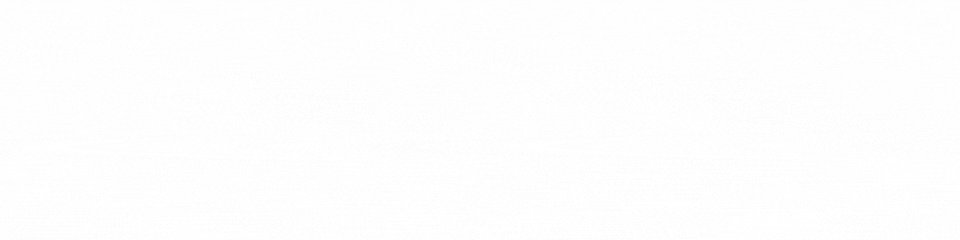„Wissen Sie eigentlich, dass ich einer der fleißigsten europäischen Brotmaler bin?“ – mit dieser Frage stellte sich der Duderstädter Künstler Ulrich Hollmann bei Agnieszka Steuerwald, Leiterin des Europäischen Brotmuseums in Ebergötzen vor. Dies war der Anfang einer äußerst kreativen und nachhaltigen Verbindung, deren Resultat die Ausstellung mit Werken von Ulrich Hollmann im Brotmuseum ist.

Hubert Kellner, Vorsitzender des Vereins Europäisches Brotmuseum e.V. als Träger, begrüßte die zahlreichen Gäste zur Vernissage. Unter ihnen befand sich auch Lajos Kossa, Bürgermeister von Aba, der ungarischen Partnerstadt Ebergötzens. Sein Sohn hatte ein Praktikum im Brotmuseum absolviert.

Als Agnieszka Steuerwald die Werke Ulrich Hollmanns, der tatsächlich Unmengen von Brotbildern auf die Leinwand gebracht hatte, zum ersten Mal sah, war für sie sofort klar: Mit dem Hollmannschen Fundus ließe sich thematisch noch viel weiter in die Tiefe gehen, als es nur mit den Brotbildern möglich gewesen wäre. „Die Natur, der Mensch und das Brot – Bilder des Lebens“, so also der bedeutungsvolle Titel, der auch sehr aktuelle Themen aufwirft: „Wie lange kann die Erde uns noch ernähren? Und was bedeutet Menschsein angesichts der Kriege und der Naturkatastrophen?“, fragte Agnieszka Steuerwald bei ihrer kurzen Einführung. Und wie kam es eigentlich dazu, dass ein Maler sich gleich in einer ganzen Bilderserie dem Brot widmet?
„Das Sehen spielt eine dominate Rolle in meinem Leben“, beschrieb Ulrich Hollmann seine Gabe, sich von seiner Umgebung und von neuen Eindrücken inspirieren zu lassen und diese dann nach eigenem Empfinden künstlerisch umzusetzen. 1937 im schlesischen Patschkau geboren, fand er als Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg im Eichsfeld eine neue Heimat. Nach seinem Abitur 1957 in Duderstadt studierte er Malerei, Grafik und Kunstpädagogik an der Staatlichen Akademie Karlsruhe. Dort lernte er auch den Maler Peter Dreher (1932 – 2020) kennen, der ab den frühen 1970-er Jahren jeden Tag bis ins hohe Alter ein Wasserglas malte. Diese Serien sind heute als „Tag um Tag guter Tag“ bekannt.
„Nachdem ich schon so viel ausprobiert hatte, faszinierte mich diese Idee, sich ganz konzentriert einer einzigen Sache zu widmen“, erklärte Ulrich Hollmann, dessen Neugier auf die Möglichkeiten der Kunst ihn bisher davor bewahrt hatte, sich auf einen bestimmten Stil festzulegen. In seiner jahrzehntelangen Schaffensphase probierte er immer wieder andere Materialien und Techniken aus. Neu und inspirierend war nun der Gedanke, sich ganz intensiv und über einen längeren Zeitraum mit einem Thema zu beschäftigen. So entstand seine Brot-Serie.
Die Bilder ähneln sich: in einem Stilleben stehen die Brote im Mittelpunkt. Sie alle liegen in einer einfachen und privat anmutenden Umgebung zum Essen bereit vor dem Betrachter, werden aber immer wieder in einen neuen Bezug gesetzt. Mal sind sie angeschnitten, mal liegt Obst daneben, mal die Tageszeitung mitsamt Schlagzeilen aus der Welt dort draußen.
Unser täglich Brot …
„Unser täglich Brot“ ist für die meisten Menschen im wahrsten Sinn des Wortes etwas Alltägliches, und dennoch etwas ganz Besonderes: Als Grundnahrungsmittel sichert es seit Jahrtausenden das Überleben. Außerdem erfuhr die Menschheitsgeschichte mit der Kunstfertigkeit, Brot herzustellen, und der damit einhergehenden Erfindung der Landwirtschaft, einen wesentlichen Fortschritt. Der Erde die Getreidekörner abzuringen, indem man beste Bedingungen für deren Gedeihen schaffte, erforderte Wissen und genaue Beobachtung der Natur. Wie lange wird es wohl gedauert haben, bis jemand auf die Idee kam, die Körner zu mahlen, einen Teig herzustellen und zu backen, um die Getreidefrucht schmackhafter und vor allem leichter verdaulich zu machen? Und wie fand der Austausch um dieses Wissen statt? Wie wurden Rezepte verfeinert und den jeweiligen regionalen und klimatischen Gegebenheiten angepasst? Brot war seit jeher also viel mehr als eine selbstverständliche Alltäglichkeit, was auch in Mythen, Märchen, Legenden und Religionen in aller Welt thematisiert wurde.
Doch nicht nur die Herstellung von Brot fördert die Wertschätzung für die Gaben der Natur, sondern auch der Mangel an Brot. Ulrich Hollmann kennt beides: Als Flüchtlingskind hat er den Hunger erfahren, viele Jahre später hat er sein eigenes Brot gebacken. Kein Wunder also, dass er seine Wertschätzung zeigt, indem das Brot die Hauptrolle in einer seiner Bilderserien spielen darf.

Der Titel der Ausstellung verrät allerdings, dass es noch mehr zu sehen gibt. Die Einführung moderierte Tina Fibiger.
Bei seiner Motivauswahl – Naturszenen, u.a. am Seeburger See oder an der Rhumequelle, Café- und Marktszenen, kleinere oder größere Menschengruppen – lässt Ulrich Hollmann den Betrachter zum stillen und unbemerkten Beobachter werden. Oft menschenleere, und doch so lebendige Landschaften, vielleicht als Spiegel des großen Ganzen, stehen im Kontrast zur kleinen Familie. Der Mann im taillierten weißen Oberhemd und mit selbstbewusster Körperhaltung könnte eine gesellschaftliche Persönlichkeit darstellen, die Frau blickt ihn an, aber wendet sie sich ihm zu oder ab? Die Umgebung der Familie ist dunkel, grau, einbetoniert. Hat sich die moderne Gesellschaft völlig von der Natur entfremdet, vom Ursprung des Seins?
Bei einer größeren Menschengruppe im Nebel scheint niemand mit jemandem in Kontakt zu stehen. Alle sind in Bewegung, doch woher kommen sie und wohin gehen sie? Die Silhouetten der Menschen lösen sich auf. Haben sie die Orientierung oder sich selbst verloren, ihre Herkunft und ihre Ziele vergessen? Und was hat das alles mit Brot zu tun?

„Das Brot steht zwischen dem Menschen und der Natur“, erklärte Agnieszka Steuerwald bei der Vernissage und lobte den Künstler Ulrich Hollmann als großen Beobachter des Lebens. Die Frage, ob die Menschheit den Bezug zu ihren eigenen Lebensgrundlagen verloren habe, stellte sich auch Hubert Kellner, der bis zu seinem Ruhestand zudem das Amt des Kreislandwirts innehatte und dementsprechend genau weiß, wie viel Arbeit dem duftenden, knusprigen Brot vorangegangen ist. „Die Wertschätzung fehlt heute, Bäckereien gibt es kaum noch und viele Menschen verlieren den Bezug zur Herkunft unserer Nahrung“, hat er festgestellt.
Die Kernaufgabe des Europäischen Brotmuseums ist, die kulturhistorische Bedeutung des Brotes und seiner Herstellung ins Bewusstsein zu bringen, aber auch den heutigen Umgang des Menschen mit seiner Nahrung, und in diesem Zusammenhang mit der Natur, zu hinterfragen. In wechselnden Ausstellungen und Projekten werden diese Themen unter neuen Aspekten und veränderten Blickwinkeln in die Öffentlichkeit gebracht. Die Hollmann-Ausstellung ist bis Anfang Dezember 2023 in Ebergötzen zu sehen.

„Und das Beste kommt zum Schluss“, verriet Angieszka Steuerwald: Die Hollmann-Werke sind käuflich erhältlich. 30 Prozent des jeweiligen Verkaufspreises gehen als Spende an das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen.
Info: brotmuseum.de
ClanysEichsfeldBlog Duderstadt EuropäischesBrotmuseum UlrichHollmann