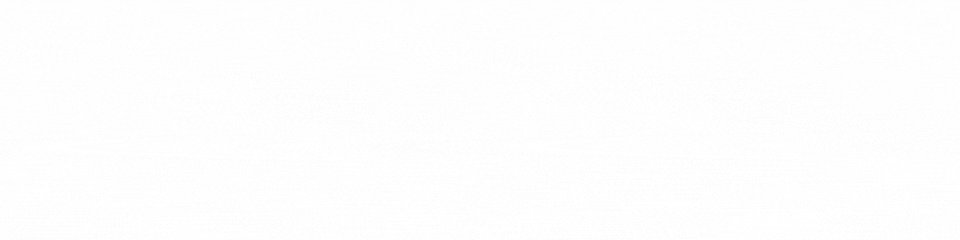Die Welt der digitalen Medien ist Jugendlichen heute äußerst vertraut. Die Welt der deutschen Teilung eher nicht. Am außerschulischen Lernort Grenzlandmuseum Eichsfeld wurden beide Welten im medienpädagogischen Projekt „Alltag im Grenzgebiet“ miteinander verknüpft. Die Ergebnisse gingen unter die Haut – nicht nur bei den teilnehmenden Schülern.
Der Bildungsverein Deutsche Gesellschaft e.V. führte das mehrteilige Filmprojekt zum Gedenken an die Grenzöffnung vor 30 Jahren durch. An drei verschiedenen grenznahen Gedenkstätten – in Mödlareuth, an Point Alpha, und am Grenzlandmuseum Eichsfeld – haben Jugendliche die jüngere deutsche Geschichte erarbeitet, indem sie Filme zu unterschiedlichen Themengebieten und in verschiedenen Techniken selbst konzipierten.

Allerdings ging es bei der Recherche nicht um Zahlen und übergeordnete politische Fakten, sondern um Einzelschicksale, um Zeitzeugen und um das Lebensgefühl der damaligen Zeit vor der Wende. SchülerInnen vom Tilmann-Riemenschneider-Gymnasium Osterode und der Bergschule St. Elisabeth Heiligenstadt haben am Projekt „Alltag im Grenzgebiet“ teilgenommen.
„Ich habe noch nie erlebt, dass Jugendliche im Hochsommer bei 30 Grad so intensiv gearbeitet haben wie bei diesem Projekt“, lobte Sandy Konradi-Rieche, pädagogische Mitarbeiterin am Grenzlandmuseum, das Engagement der SchülerInnen. Nach einer Woche sind drei Kurzfilme entstanden. Die Jugendlichen haben selbst die Drehbücher geschrieben, Interviews mit Zeitzeugen geführt, Animationen konzipiert, Filmszenen gedreht, den Ton dazu eingebracht und auch den Schnitt übernommen. Medienpädagogische Unterstützung gab es von den Landesmedienanstalten Thüringen und Niedersachsen.
Was dabei herausgekommen ist, präsentierten die ProjektteilnehmerInnen der Öffentlichkeit.
1) Spielfilm „Wir machen rüber“ – Dariush, Vincent, Frederik und Levi drehten eine szenische Darstellung von drei jungen Menschen in der DDR, die ihre Flucht in den Westen planen:

Die Lehre im Handwerk macht bei Materialmangel und nicht erfüllbaren Zielen der Planwirtschaft ebenso unzufrieden wie der Zwang, sich vor dem Studium drei Jahre für die Armee verpflichten zu müssen. Und bei den Wahlen gibt es auch keine Wahl. Michael, Stephan und Erik beschließen: „Wir machen rüber“. Ihr Kumpel Thomas kriegt das mit – und verpfeift die drei.
Das Ende des Kurzfilms bleibt offen. Aber die filmisch geschaffene Atmosphäre zwischen Frust, Angst, Hoffnung und Misstrauen erzeugt nicht nur Spannung, sondern wirkt auch authentisch. Die vier Laien-Darsteller scheinen sich intensiv mit den gespielten Charakteren und deren Lebensumfeld beschäftigt zu haben und können das glaubwürdig vermitteln.
2) Zeitzeugen: „Leben im Schatten der Grenze“ – Eine filmische Kollage von Sarah, Saskia und Emma:

Menschen aus der Region erzählen vom Alltag auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze: von den harten Einschränkungen im Sperrgebiet der DDR, von Mangelwirtschaft und Passierscheinen, von der Jugend als Pionier, von Unwissenheit und Ahnungen, und von der Grenzöffnung. Auch daran hat jeder ganz einzigartige Erinnerungen – der BGS-Beamte an der Berliner Mauer ebenso wie die damals Jugendliche aus Thüringen.
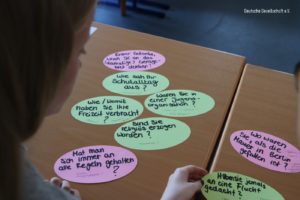
Die kurzen, aber prägnanten Sätze der Zeitzeugen spiegeln ein menschliches und emotionales Bild aus der Zeit vor und während der Grenzöffnung wider. Auswahl der Statements und Schnitt des Films wirken professionell. Die Fragen waren gut überlegt, doch im Film stehen die Antworten im Vordergrund, was auch der Spannung zugute kommt.
3) Erklärvideo – Robert, Lennart und Jakob drehten eine Animation, in der Großeltern ihrem Enkelkind den Alltag in der DDR erklären:
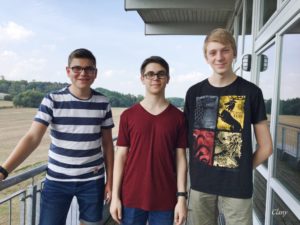
Die Großeltern wohnen im Sperrgebiet der DDR, wo sie gleichermaßen die Abgrenzung zur übrigen DDR-Bevölkerung und die Abgrenzung zur BRD erleben. Privateigentum wie der kleine Lebensmittelladen wurde enteignet. Die dauerhafte Überwachung durch die Stasi und Fluchtgeschichten sind Thema beim Gespräch mit dem Enkelkind.
„Alltag im Grenzgebiet“ wird im Trickfilm anschaulich und leicht nachvollziehbar dargestellt. Der Film kann auch jungen Zuschauern nahebringen, wie die staatlichen Einschränkungen das Leben der Menschen im Sperrgebiet belastet haben. Eindrucksvoll ist zudem der Aufwand, der hinter der technischen Umsetzung einer solchen nicht nur zeichnerisch, sondern auch inhaltlich ansprechenden Animation in nur einer Projekt-Woche steht.

Die Reaktionen des Publikums waren eindeutig. Der große Applaus für die Leistungen der Schüler, und vor allem für ihre intensive, kreative und nachhaltige Beschäftigung mit dem Thema „Alltag im Grenzgebiet“, war verdient.
Die Filme werden nicht nur im Blog der Deutschen Gesellschaft e.V. veröffentlicht, sondern sollen auch bei anderen Veranstaltungen zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung öffentlich gezeigt und bei Schulprojekten verwendet werden, sagte Kilian Geiger, Referent der Deutschen Gesellschaft e. V.
Wie wichtig sind also außerschulische Lernorte?
Die Zitate der SchülerInnen sprechen für sich:
„Ich stand hinter der Kamera und war völlig gefesselt von dem, was ich von den Zeitzeugen gehört habe. Das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben.“
*
„Um diese Inhalte zusammenzustellen, haben wir uns vor allem an den Zeitzeugengesprächen orientiert. Was die Leute erzählt haben, ist für uns heute kaum zu glauben. Ich hätte da noch stundenlang zuhören können.“
*
„Manches beim Filmen war sehr witzig, aber wir haben auch so viel gelernt – über Geschichte und die Zeit in der DDR und über das Filmemachen. Unser Dank gilt besonders Sven Jansen von der Landesmedienanstalt Thüringen für die richtig tolle Unterstützung.“
*
„Ich war vorher noch nie im Grenzlandmuseum, aber ich würde gern wiederkommen. Hier bekommt man viel mehr Info als im Geschichtsunterricht.“
*
„In der Schule lernt man vor allem Daten und betrachtet die Geschichte von oben, aber man taucht nicht ein und erfährt nichts über Einzelschicksale.“
*
„Mit den Daten kann ich nun etwas anfangen. Die werden mir ein Leben lang etwas bedeuten: 13. August 1961, 9. November 1989, 3. Oktober 1990.“
*
„Über die Erfahrungen hier im Grenzlandmuseum merkt man sich vieles aus dem Geschichtsunterricht besser.“
*
„Die ältere Generation unterscheidet immer noch zwischen Ost- und Westdeutschland. Für uns gibt es da überhaupt keine Unterschiede, wir kennen nur einen deutschen Staat.“
*
Das medienpädagogische Projekt in Teistungen ist Teil des Projekts, das von der Deutschen Gesellschaft e. V. aus Berlin in Zusammenarbeit mit dem Grenzlandmuseum Eichsfeld, der Point Alpha Stiftung und dem Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth durchgeführt wird. Medienpädagogische Partner sind die Landesmedienanstalten aus Thüringen, Niedersachsen, Bayern und Hessen. Gefördert wird das Projekt durch den Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
ClanysEichsfeldBlog GrenzlandmuseumEichsfeld AlltagImGrenzgebiet DeutscheGesellschafteV